Gab es die Stomaversorgung schon vor vielen hunderten Jahren? Wie hat sich die Geschichte der Stomaversorgung entwickelt?
Auch wenn man es sich schwer vorstellen kann, so werden doch schon seit über 2000 Jahren Operationen am Darm durchgeführt.
Eine der ersten Ausleitungen des Darmes aus dem Bauchraum nach außen hat z.B. der griechische Arzt Praxagoras auf der Mittelmeerinsel Kos im Jahre 350 v. Chr. durchgeführt. Der Patient hatte eine einen eingeklemmten Leistenbruch, der unbehandelt zum Platzen des Darmes führen und somit tödlich sein kann.
Im Jahre 1710 wurde durch den französischen Kinderarzt Littre beobachtet wie ein Säugling an den Folgen einer Analatresie (angeborene Missbildung des Analkanals) stirbt. Er schlägt als Behandlungsmöglichkeit eine Colostomie vor.
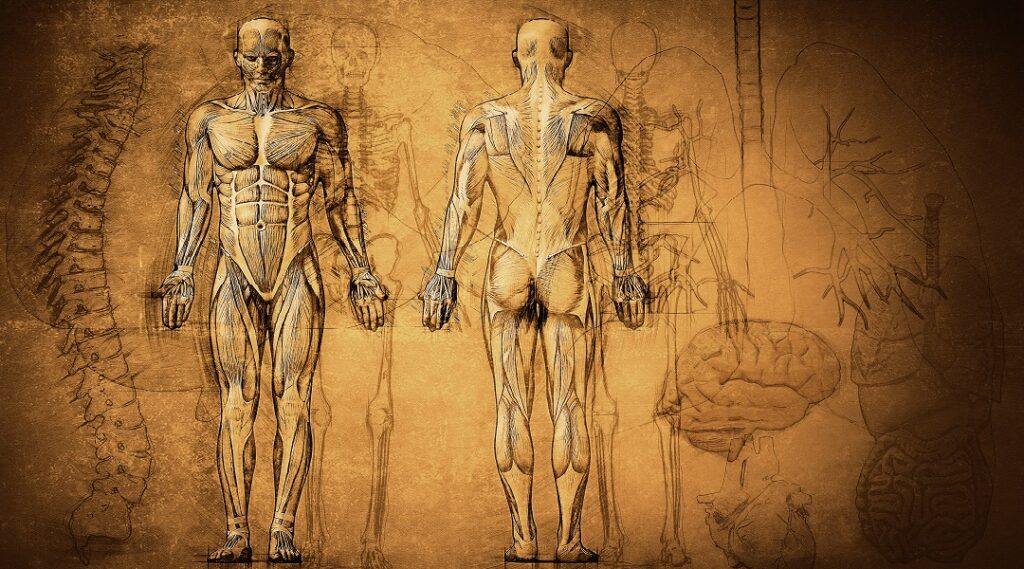
Ebenfalls in Frankreich wurde im Jahr 1776 durch den Chirurgen Pillore eine Coecostomie bei Darmverschluss durchgeführt. Hier wurde auch zum ersten Mal die Darmwand in die Haut eingenäht.
1793 wurde durch Duret (Frankreich) bei einem wenige Tage alten Säugling eine Colostomie angelegt, wie sie bereits 80 Jahre zuvor diskutiert wurde.
1855 wird in Deutschland (Thiersch) eine Sigma-Resektion mit Anastomose und temporärer Transversostomie durchgeführt.
Um ein Zurückziehen des Darmes zu verhindern, wird im Jahre 1884 ein Gänsekiel als Reiter eingesetzt.
Die Technik der abdomino-sacralen Rektumamputation wird im Jahre 1904 durch den Amerikaner Mayo beschrieben.
Um die Pflege zu erleichtern, werden im Jahre 1927 in England regelmäßige Einläufe empfohlen. Eine Vorstufe der heutigen Irrigation. Versorgungsmöglichkeiten zum Auffangen des Stuhls gab es bis dato nicht. Der Betroffene musste sich mit Lappen oder Zellstoff Nestern begnügen.
Der erste Beutel als Mehrwegprodukt wurde 1935 durch König und Rützen in Deutschland vorgestellt. Es handelt sich um einen Gummibeutel mit Gürtel, die sogenannte Pelotte.
In den 1954 Jahren wurde in Dänemark der erste Einwegbeutel mit Zinkoxydklebefläche entwickelt.
Mit der Entdeckung des indischen Baumharzes Karaya für die Stomaversorgung gab es zum ersten Mal hygroskopische Eigenschaften und die erste Form von Hautschutz. Heute besteht der klassische Hautschutz aus Gelatine, Pektinen und Zellulose. Somit werden hautfreundliche und haftende Eigenschaften miteinander kombiniert. Die Entwicklung von gewölbtem Hautschutzmaterial zur Versorgung zurück gezogener Stomata hat wesentlich zur Versorgungsqualität beigetragen.
In der Krankenpflege bekam die Betreuung der Stomapatienten einen besonderen Stellenwert. So kam es 1968 in den USA zur Gründung der North American Association of Enterostmal Therapists.
In Deutschland wird 1978 der erste Ausbildungsgang in der Stomatherapie nach den Richtlinien des WCET (World Council of Enterostomal Therapists) in Düsseldorf durchgeführt.
1979 kam es zur Gründung des DVET- der Deutschen Vereinigung der Enterostoma-Therapeuten. Diese ging letztendlich 2010 in die neugegründete FgSKW (Fachgesellschaft Stoma, Kontinenz, Wunde) über. Die FgSKW ist heute maßgeblich für die berufspolitische Ausrichtung und die inhaltliche Qualität der mittlerweile zweijährigen Weiterbildung verantwortlich.
Auf Seiten der Betroffenen wurde bereits 1973 die Deutsche ILCO e.V. (Deutsche Ileostomie, Colostomie Vereinigung) gegründet. Eine weitere Interessenvertretung wurde mit der Stomawelt e.V. im Jahre 2000 gegründet.
In Deutschland gibt es heute ca. 150.000 Betroffene mit Stoma Anlagen. In Europa sind es ca. 70.000. Die Quote beträgt hier ca. 0,14 % der Bevölkerung.
Die Anzahl der Neuanlagen liegt in Deutschland bei ca. 42.000 / Jahr. Hiervon sind inzwischen die meisten temporär. Bei ca. 8 % der geplant vorübergehenden Anlagen kommt es nicht zur Rückverlagerung. Das Verhältnis der unterschiedlichen Anlagen liegt bei ca. 60 % Colostomie, 25 % Ileostomie und ca. 15 % Urostomie.
Hauptindikation bleiben Karzinome, gefolgt von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
Bekannte Stomaträger waren z.B. Fred Astaire, Napoleon Bonaparte, Queen Elisabeth sowie Karol Wojtyla.
Der heutige Markt an Stomaprodukten umfasst ein Sortiment von mehreren Tausend Artikeln. Diesen Markt teilen sich größtenteils sechs Hersteller auf. Hinzu kommen noch diverse kleinere oder auch Nischenanbieter.
In Deutschland haben die Versicherten Anspruch auf eine ausreichende und zweckmäßige Versorgung mit Hilfsmitteln zur Stomaversorgung.
Diese Hilfsmittel müssen vom GKV Spitzenverband in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen werden. Hierzu müssen Anforderungen an die Qualität, die Funktion, die Sicherheit sowie den medizinischen oder pflegerischen Nutzen nachgewiesen werden.
Der Versicherte hat gegenüber seiner Krankenkasse einen Anspruch auf diese Hilfsmittel, soweit sie in seinem individuellen Fall medizinisch notwendig sind. Grundlage der Erstattung ist eine ärztliche Verordnung (Rezept).
Jeder Versicherte hat einen Eigenanteil von z.Zt. 10 € /Monat an seiner Stomaversorgung zu leisten. Dieser Betrag wird dem Leistungserbringer direkt von der Vergütung der Krankenkasse abgezogen. Versicherte, die von Zuzahlungen befreit sind, müssen dieses dem Leistungserbringer nachweisen.
Produkte, die nicht in dem Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen sind, werden als medizinisch nicht notwendig angesehen und sind somit auch nicht in der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen.
Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen (2016) für Stomaprodukte liegen bei ca. 250 Mio. € jährlich. Der prozentuale Anteil aller Hilfsmittel an den Gesundheitskosten macht nur ca. 3,72 % aus. Von dieses 3,72 % beträgt der Anteil der Stomaprodukte gerade mal 3,19 %. Der Anteil an den Gesamtkosten im deutschen Gesundheitswesen liegt bei nur 0,11 %.
Trotz dieser vergleichsweise geringen Bedeutung sind die Kosten für Stomaprodukte bei den Krankenkassen stark im Fokus. So geht in den letzten Jahren die monatliche Erstattung für die Leistungserbringer kontinuierlich zurück. Hierbei ist zu beachten, dass alle Folgekosten sparenden Dienst- und Serviceleistungen durch examiniertes und weitergebildetes Fachpersonal mit der monatlichen Vergütung abgegolten sind. Dieser Kostendruck führt dazu, dass sich viele Leistungserbringer aus der Stomaversorgung zurückziehen. Ob hier signifikante Einsparungen für das Gesundheitswesen erzielt werden, darf daher bezweifelt werden.









4 Antworten zu “Die Geschichte und Entwicklung der Stomaversorgung”
Ich habe mein stoma vom 1.tag meines Lebens. 14.02.1949
Ich lebe damit gut. Ich würde mich über eine Kontaktaufnahme freuen.
Sehr geehrter Herr Geschke,
vielen Dank für Ihren Kommentar. Aus Datenschutzgründen haben wir Ihre Telefonnummer entfernt. Ihren Kontaktwunsch nehmen unsere Kolleginnen und Kollegen des Kundenservice gerne entgegen.
Beste Grüße
In der momentanen Situation in Europa geht mir viel durch den Kopf.
Haben Sie Tipps für Stomaträger, wenn die Hilfsmittelversorgung füt längere Zeit ausfällt?
Würde mich freuenvon Ihnen zu hören.
Gerhard Wurstbauer
Hallo Herr Wurstbauer,
danke für Ihr Vertrauen sich an uns, die GHD GesundHeits GmbH Deutschland, zu wenden.
In diesen wirklich unruhigen und beängstigenden Zeiten können wir Ihre Sorge durchaus verstehen.
Ja, viele Unternehmen in allen möglichen Branchen haben zunehmend Ausfälle oder Verzögerungen bei der Lieferung von Rohstoffen.
Auch kann es vorübergehend zu Lieferengpässen durch Verlagerung von Produktion im Ausland kommen.
Wir denken, dass im Laufe der letzten zwei Jahre, geprägt durch die Situation der Pandemie, sich dennoch gerade Unternehmen in der Gesundheitsbranche auf diese Anforderungen eingestellt haben, um Ihre Kunden weiter beliefern zu können.
Wir, die GHD, sind in diesem Markt als Dienstleistungsunternehmen sehr gut aufgestellt, da wir einerseits unsere Kunden produktneutral beliefern, aber auch entsprechend in problematischen Versorgungssituationen beraten können. Außerdem gibt es auch Hersteller von Stomaprodukten, welche direkt in Deutschland produzieren, wie zum Beispiel FORLIFE in Berlin, mit diesen Produkten können wir unsere Kunden ggf. dann beliefern, wenn die Versorgungssituation es zulässt.
Grundsätzlich haben die in Deutschland ansässigen Home Care Unternehmen Lagerbestände, die für evtl. Engpässe die Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln absichern und aufrechterhalten können.
Wir empfehlen unseren Kunden allgemein, immer einen kleinen Vorrat an Stomaprodukten, wie Ausstreifbeutel (zum Beispiel für die Situation von Durchfallerkrankungen oder Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln), mitzubestellen.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein wenig Sicherheit, Ihre zukünftige Versorgung betreffend vermitteln.
Beste Grüße