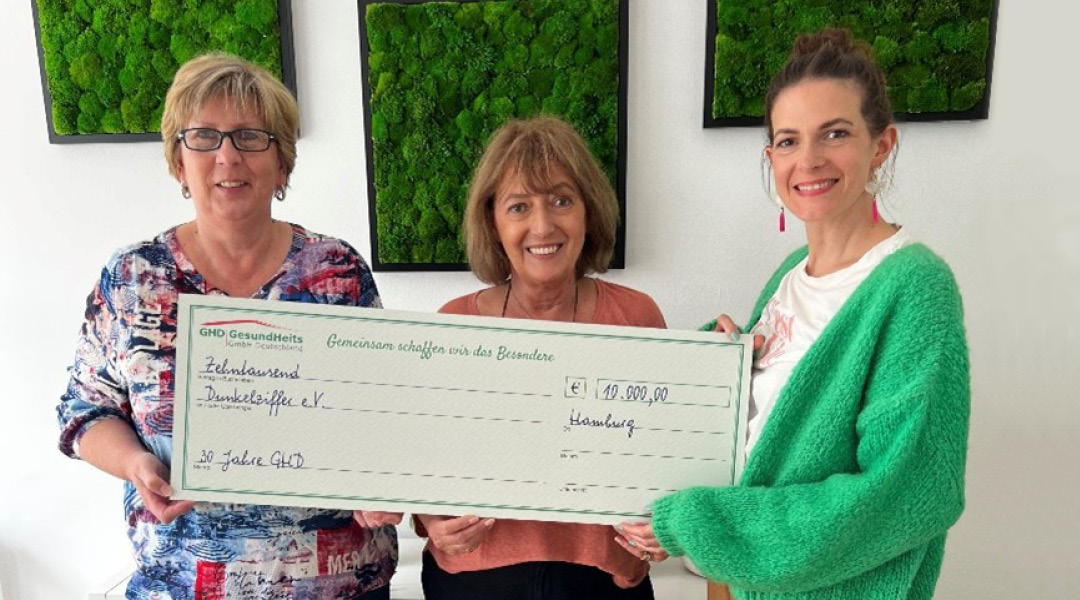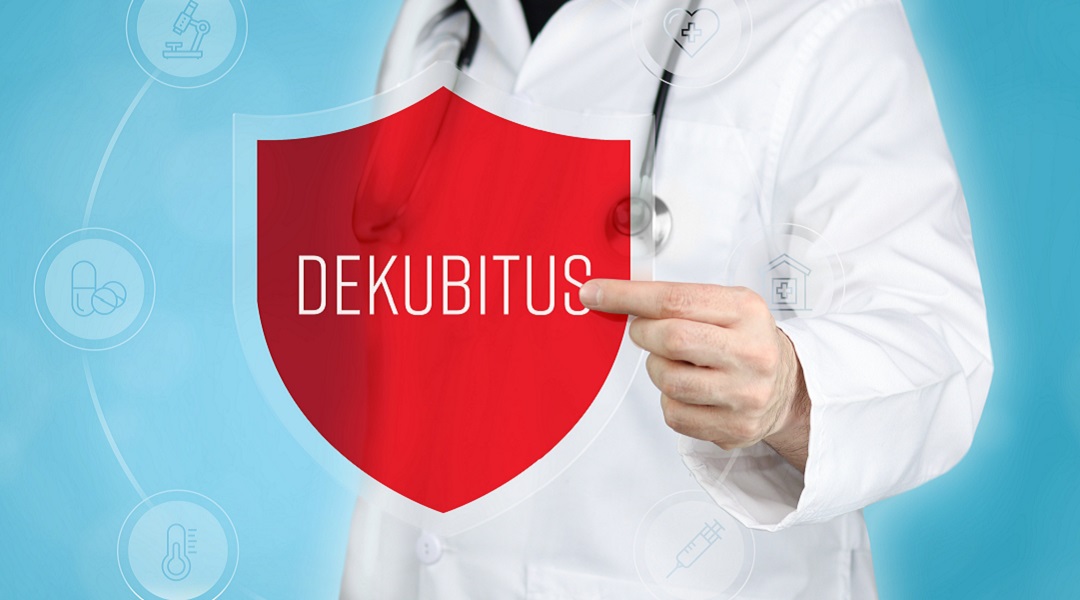Was ist der Unterschied zwischen einer Allergie und einer Intoleranz?
Die Begriffe Allergie und Intoleranz (Unverträglichkeit) werden im Alltag oft synonym verwendet. Dass es sich hierbei aber um zwei verschiedene Krankheitsbilder handelt, ist vielen gar nicht bewusst. Was ist der